Die Notwendigkeit von Ausgleichsmechanismen im Stromnetz der Zukunft
Westeuropas Wandel hin zu erneuerbaren Energien erhöht die Schwankungen in der Stromversorgung. Gleichzeitig bringt die Elektrifizierung von Verkehr und Heizung einerseits flexible, andererseits aber auch schwer vorhersehbare Nachfrage mit sich. Im Gegensatz zu herkömmlichen fossilen Kraftwerken erfordern dezentrale Energieressourcen (DERs) wie E-Autos, Wärmepumpen und Dachanlagen eine intelligente Koordination. Regelenergiemärkte dienen als Echtzeit-Sicherheitsnetz und können Abweichungen zwischen Angebot und Nachfrage in Sekundenschnelle korrigieren, sollten die Prognosen daneben liegen.
In Europa halten die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNBs) die Netzfrequenz präzise bei 50 Hertz (Hz). Bereits winzige Abweichungen (in der Größenordnung von 0,2 Hz) können zu Ausfällen führen. Um dies zu verhindern, beschaffen die ÜNBs Regelleistungen, die Strom bei Bedarf schnell einspeisen oder aufnehmen können. Diese Dienstleistungen werden über verschiedene Produkte bereitgestellt, die nach der Reaktionszeit aufgeteilt werden:
- Primärregelleistung (FCR, Frequency Containment Reserve): Eine Primärreserve, die innerhalb von circa zehn Sekunden reagiert, um die Frequenz zu stabilisieren.
- Sekundärregelleistung (aFRR, Automatic Frequency Restoration Reserve): Eine Sekundärreserve, die automatisch innerhalb von circa 30 Sekunden aktiviert wird, um das Frequenzgleichgewicht wiederherzustellen.
- Tertiärregelleistung (mFRR, Manual Frequency Restoration Reserve): Eine Tertiärreserve, die innerhalb von Minuten (manuell oder halbautomatisch) aktiviert wird, um die früheren Reserven zu ersetzen und größere Ungleichgewichte im Netz zu beheben.
Wie Regelenergiemärkte in Westeuropa funktionieren
Regelenergiemärkte in Westeuropa sind regulierte Regelmechanismen, die von den Verteilernetzbetreibern (VNBs) in jedem Land beaufsichtigt werden und meist EU-weit koordiniert sind. Im Gegensatz zum Ausgleichsmarkt,der Abweichungen nachträglich ausgleicht, werden Regelenergiemärkte genutzt, um Flexibilität im Voraus zu beschaffen und das Netz in Echtzeit stabil zu halten. Anbieter von Regelleistung, etwa Energieerzeuger, flexible Lasten oder Speicher, verpflichten sich, auf Abruf ihre Einspeisung oder ihren Verbrauch anzupassen, sobald der Netzbetreiber dies signalisiert. Tritt ein Ungleichgewicht auf, werden diese Reserven aktiviert. Die Anbieter erhalten für die eingespeiste oder abgenommene Energie eine Vergütung zum Ungleichgewichtspreis.
Abrechnung von Ungleichgewichten und Preissignalen
Eine Ausgleichsabrechnung stellt sicher, dass alle Teilnehmer:innen am Strommarkt ihr Portfolio im Gleichgewicht halten. Abweichungen von den Prognosen werden zum Preis der Regelenergie abgerechnet. Strafzahlungen sollen dabei die Genauigkeit anregen. Regelenergiemärkte dienen somit als Echtzeit-Stabilisator und finanzielles Abrechnungssystem für Ungleichgewichte.
Öffnung der Märkte für kleinere Anlagen
Früher waren Regelenergiemärkte auf große Erzeuger und Industrieanlagen beschränkt. Heute können alle Ressourcen einzeln oder über Aggregatoren teilnehmen. Dieser regulatorische Wandel ermöglicht es, dass dezentrale Energieressourcen (DERs) wie Heim-Batterien,batterie betriebene E-Autos (BEVs) und Photovoltaik(PV)-Anlagen in großem Umfang Flexibilität bereitstellen können.
Verschiebung hin zu schnellerem Echtzeit-Ausgleich
Westeuropa verkürzt die Abrechnungs- und Kontrollperioden auf 15 oder sogar 5 Minuten, um Schwankungen durch erneuerbare Energien besser zu steuern. Märkte wie die in den Niederlanden aktualisieren die Preise und Systemgleichgewichtsdaten bereits alle paar Minuten, um eine schnelle Reaktion der Teilnehmenden zu ermöglichen.
Koordination zwischen ÜNB und VNB
Da mehr Flexibilität aus Verteilungsnetzen stammt, müssen die ÜNB und VNB sich abstimmen, um lokale Überlasten im Netz zu vermeiden. Pilotprojekte testen Möglichkeiten, Anlagen wie EVs, Wärmepumpen und Batterien für den nationalen Ausgleich zu nutzen, ohne die lokale Netzstabilität zu beeinträchtigen.
Flexibilität von Haushalts-Energieanlagen: BEVs, PV, Batterien und Wärmepumpen

Schwere Haushalts-Energieanlagen – E-Fahrzeuge, Photovoltaik(PV)-Anlagen, Batteriespeicher und Wärmepumpen – können bei intelligenter Verwaltung erhebliche Energie-Flexibilität bieten.
Batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs)
E-Autos funktionieren wie große, steuerbare Batterien. Intelligentes Laden kann den Stromfluss über V2G (Vehicle-to-Grid) verschieben oder umkehren. So kann die Zeit, in der das Fahrzeug ohnehin am Stecker hängt, genutzt werden, um das Netz zu unterstützen. Aggregatoren können ganze Flotten für die Frequenzregelung koordinieren und gleichzeitig sicherstellen, dass die Ladeanforderungen der Besitzer:innen erfüllt werden.
Solar-PV-Anlagen
Während der PV-Ertrag vom Sonnenlicht abhängt, verringern Energiemanagementsysteme die Einspeisung, um Netzüberlastungen zu vermeiden. In Kombination mit Batterien oder EV-Ladesäulen kann überschüssiger Mittagsstrom für die Abendstunden gespeichert werden. Dadurch werden Einspeise-Zuschläge vermieden und die Netz-Ungleichgewichte reduziert.
Heimbatterien
Haushaltsbatterien können sich innerhalb von Sekunden entladen oder laden, indem sie bei geringem Angebot Strom ins Netz abgeben (Aufwärtsregelung) oder bei überschüssigem Angebot Strom aufnehmen (Abwärtsregelung). Einzelne Heimbatterien sind meist zu klein, um allein am Regelenergiemarkt teilzunehmen. Werden sie jedoch zu Flotten aggregiert, können sie sich qualifizieren. Im Vereinigten Königreich erfordert die kurzfristige Betriebsreserve beispielsweise eine aggregierte Kapazität von mindestens 3 Megawatt.
In Deutschland erleichtern aktuelle regulatorische Änderungen den Hausbesitzer:innen die Rückspeisung von Strom ins Netz, während die Mindestkapazität für den Zugang zu Regelenergiemärkten noch nicht festgelegt wurde. So können Hausbesitzer:innen und Anlagenbetreiber:innen Einnahmen erzielen, die Widerstandsfähigkeit des Netzes verbessern und gleichzeitig den Eigenverbrauch maximieren.
Wärmepumpen und andere Geräte
Wärmepumpen haben einen integrierten thermischen Speicher, der kurzfristige Lastverschiebungen ohne Komfortverlust ermöglicht. Aggregatoren können eine Vorheizung, Vorkühlung oder Verzögerung des Betriebs veranlassen, um das Netz zu stabilisieren. Andere intelligente Heizungs- und Klimaanlagen wie Warmwasserspeicher oder Klimaanlagen tragen ebenfalls zu dieser Flexibilität bei
Die Rolle des HEMS
Home-Energy-Management-Systeme (HEMS) optimieren diese Anlagen für die Bedürfnisse der Hausbesitzer:innen während es auf Preis- oder Netzsignale reagiert. Plattformen wie XENON schaffen Transparenz, sodass Nutzer:innen wissen, wann ihre Anlagen die Netzstabilität unterstützen. So werden Verbraucher:innen zu Prosumern, einer wichtigen Stütze für die Integration erneuerbarer Energien.
Das Geschäft mit der Flexibilität: Aggregatoren und Virtuelle Kraftwerke

Regelenergiemärkte schaffen neue Umsatzpotenziale für Unternehmen, indem sie Flexibilität monetarisieren. Aggregator:innen machen dies möglich, indem sie dezentrale Anlagen von Heimbatterien und E-Autos bis hin zu PV-Anlagen und Wärmepumpen zu einem virtuellen Kraftwerk (Virtual Power Plant, VPP) bündeln. Dieses erfüllt die Marktanforderungen und kann auf die Signale der Verteilnetzbetreiber:innen reagieren. Die Flexibilitätsfunktion des Energiemanagementsystems von gridX, XENON Flex, integriert und steuert dezentrale Energieanlagen, aggregiert und disaggregiert ihre Flexibilität und optimiert die gebündelten Anlagen ganzheitlich. Gleichzeitig gewährleistet sie die Netzstabilität und den Komfort der Endkund:innen. XENON Flex interagiert mit Partner:innen, um die aggregierte Flexibilität zu handeln oder zu steuern. Energieversorger können so neue, zukunftssichere Umsatzströme erschließen, das Beste aus der bereits installierten Flexibilität herausholen und ihren Kund:innen Mehrwert bieten.
Aggregatoren kümmern sich um die Komplexität für kleinere Akteure von der Prognose und Echtzeitsteuerung bis zur Zusammenarbeit mit lizenzierten Händlern. Zum Beispiel identifiziert und erschließt gridX Flexibilität, während ein Handelspartner die Gebote auf dem Markt ausführt. Die Kund:innen sehen lediglich, dass ihre Geräte wie gewohnt laufen und dabei Einsparungen oder Einnahmen erzielen. Die Geschäftsmodelle variieren: Einige teilen Einnahmen mit den Verbraucher:innen, andere helfen Versorger:innen, Ausgleichskosten zu senken oder Netzausbau zu vermeiden. Häufig wird der „Value Stacking”-Ansatz verfolgt: Dieselbe Anlage kann mehreren Märkten dienen. Eine Batterie kann beispielsweise den solaren Eigenverbrauch maximieren und gleichzeitig Einnahmen aus Regelleistungen erzielen.
Das Umsatzpotenzial ist immens. Auf dem Ausgleichsmarkt in den Niederlanden kann ein Heimsystem bis zu 6 Euro pro Tag oder rund 180 Euro pro Monat einbringen. gridX-Simulationen zeigen, dass bei der Teilnahme an verschiedenen Märkten eine optimierte PV-Anlage, ein Speicher, eine E-Auto-Ladestation und eine Wärmepumpe jährlich 1.438 Euro netto generieren und die Energiekosten um über 1.300 Euro senken können. Die Teilnahme erfordert strikte Konfomität und Zuverlässigkeit. Plattformen wie XENON Flex stellen genau das sicher, indem sie die Kommunikation mit den VNB, die sichere Gerätesteuerung, die Leistungsüberprüfung und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften verwalten. Dies ermöglicht Partnern den Zugang zu Flexibilitätsmärkten, ohne eine eigene Handelsinfrastruktur aufbauen zu müssen.
Expert:innen-Einblicke: Flexibilität mit XENON Flex monetarisieren
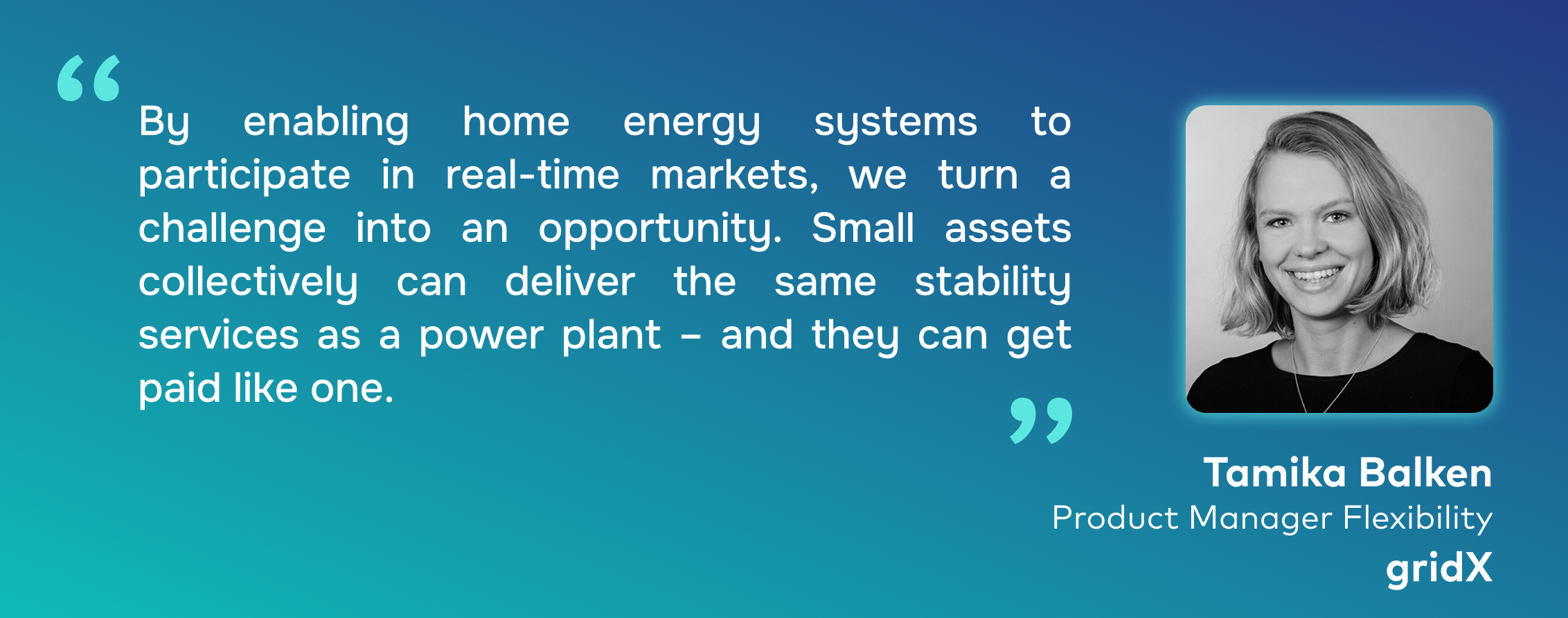
Irene Guerra Gil, Energiemarkt-Expertin bei gridX, sieht die Konvergenz von Technologie und Märkten als Wendepunkt für dezentrale Flexibilität. Sie erklärt, dass die aktive Teilnahme von Prosumern an den Energiemärkten „eine große Chance ist, Werte zu erschließen. Nicht nur für die Endkund:innen durch Kosteneinsparungen, sondern auch für Unternehmen, die dezentrale Anlagen nutzen“. Eine Plattform, die die technische Komplexität verwaltet und die Einhaltung von Vorschriften durch standardisierte APIs mit Marktbetreibern sicherstellt, ermöglicht es Unternehmen, Lösungen schnell zu skalieren und den Umsatz durch fortschrittlichen Handel in Kombination mit anderen innovativen Funktionen zu maximieren.
Tamika Baken, Produktmanagerin Flexibilität bei gridX, sagt, dass es darum geht, Innovation und Regulierung zusammenzuführen: „Indem wir Heimsystemen die Teilnahme an Echtzeit-Märkten ermöglichen, verwandeln wir eine Herausforderung in eine Chance. Kleine Anlagen können zusammen die gleichen Stabilitätsdienste wie ein Kraftwerk erbringen und sie können dafür auch wie ein solches bezahlt werden.“ Partnerschaften sind essentiell. Hersteller liefern flexible Anlagen, gridX optimiert sie über HEMS-Software und lizenzierte Marktteilnehmer führen Handelsgeschäfte aus. Die Fähigkeit von XENON Flex, sich in mehrere Verteilnetzbetreiber und Handelsplattformen zu integrieren, gewährleistet Einhaltung und Skalierbarkeit. Das Design priorisiert Vertrauen der Nutzer:innen durch Transparenz und die Berücksichtigung von Präferenzen. Für Irene Guerra Gil ist das doppelte Ziel klar:
„Mache Häuser smarter, autonomer und besser vorbereitet für alle Herausforderungen, die das Stromnetz mit sich bringt“
und liefere gleichzeitig greifbare finanzielle Vorteile.
Regelenergiemärkte sind nicht mehr nur großen Versorgern vorbehalten. Mit digitalen Plattformen wie XENON Flex wird die aggregierte Flexibilität zu einer Stütze der Energiewende. Sie erhöht die Stabilität, integriert erneuerbare Energien, belohnt die Verbraucher:innen und reduziert die Abhängigkeit von umweltschädlichen Spitzenlastkraftwerken.



