Was ist § 19 EEG?

Paragraf 19 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) legt in der aktuellen Fassung vom Februar 2025 den Zahlungsanspruch für Strom aus erneuerbaren Energien fest. Der Paragraf regelt insbesondere den Anspruch auf die Marktprämie, einen finanziellen Ausgleich, den Anlagenbetreiber im Rahmen der Direktvermarktung erhalten, wenn sie Strom aus erneuerbaren Quellen an der Börse verkaufen, sowie den Anspruch auf den Mieterstromzuschlag.
Voraussetzung für diese Zahlungen ist, dass für denselben Strom kein vermiedenes Netzentgelt nach Paragraf 18 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) in Anspruch genommen wurde. Vermiedene Netzentgelte konnten bislang von Betreibern dezentraler Erzeugungsanlagen beansprucht werden, wenn ihre Einspeisung dazu beitrug, dass Strom nicht über vorgelagerte Netzebenen transportiert werden musste. Sie stellen also eine Art Vergütung für die netzentlastende Wirkung dezentraler Anlagen dar. Aufgrund von Reformen sind diese Zahlungen für Neuanlagen allerdings weitgehend entfallen und bestehen nur noch in Übergangsfällen.
Zweck und Zielsetzung von §19 EEG
Ziel von § 19 EEG ist es, Betreibern von Anlagen mit erneuerbaren Energien die Teilnahme am Strommarkt zu ermöglichen. Durch die Direktvermarktung sollen sie eigenständig Erlöse an der Strombörse erzielen können. Dabei wird die bisherige feste Vergütung zurückgedrängt und das marktwirtschaftliche Verhalten gestärkt. Auf diese Weise trägt der Paragraf dazu bei, die Effizienz und Flexibilität erneuerbarer Energien im Stromnetz zu verbessern.
Zahlungsansprüche nach Paragraf 19 EEG
§ 19 EEG regelt die Vergütungsansprüche für Strom aus erneuerbaren Energien und Grubengas. Anlagenbetreiber können eine Marktprämie erhalten, wenn sie Strom direkt an der Börse verkaufen, oder einen Mieterstromzuschlag, wenn sie Strom lokal an Endverbraucher:innen liefern. Darüber hinaus besteht auch ein Anspruch auf die Einspeisevergütung, wenn der Strom vollständig an den Netzbetreiber abgegeben und nicht selbst vermarktet wird. Die Zahlungen dienen als finanzieller Ausgleich zur Sicherung der Einnahmen aus der Direktvermarktung. Grundlage für die Höhe der Zahlungen ist die Differenz zwischen dem geltenden Wert und dem erzielten Marktpreis. Die Zahlung erfolgt über den Netzbetreiber oder einen Direktvermarkter.
Voraussetzung für den Zahlungsanspruch
Damit Anlagenbetreiber Zahlungen gemäß § 19 EEG erhalten können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Der erzeugte Strom muss aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammen und entweder direkt vermarktet oder als Mietstrom genutzt werden. Darüber hinaus dürfen für denselben Strom keine vermiedenen Netzentgelte gemäß § 18 der Netzentgeltverordnung geltend gemacht werden. Die gleichzeitige Inanspruchnahme beider Fördermechanismen ist ausgeschlossen. Der Zahlungsanspruch gilt nur für Kalendermonate, in denen Strom tatsächlich ins Netz eingespeist oder geliefert wurde.
Wie funktioniert die Marktprämie?
Die Marktprämie ist ein finanzieller Ausgleich für Betreiber, die Strom aus erneuerbaren Energien an der Börse verkaufen. Sie ersetzt die klassische Einspeisevergütung und wird zusätzlich zum Marktpreis ausgezahlt, wenn dieser unter dem anzulegenden Wert liegt. Auf diese Weise sichert sie den wirtschaftlichen Betrieb von Anlagen in der Direktvermarktung. Die Marktprämie wird monatlich berechnet und ausgezahlt, wobei der Netzbetreiber die Abwicklung übernimmt.Die Höhe der Marktprämie ist nicht fest, sondern ergibt sich jeweils aus der Differenz zwischen Marktpreis und anzulegenden Wert. Die aktuellen und historischen Werte veröffentlicht die Bundesnetzagentur monatlich auf ihrer Website im Rahmen der Marktprämienübersicht.
Berechnung der Marktprämie
Für die Berechnung der Marktprämie wird der Unterschied zwischen dem anzulegenden Wert und dem durchschnittlichen Marktwert für den eingespeisten Strom als Grundlage genommen. Sollte der Marktwert an der Börse unter dem anzulegenden Wert liegen, gleicht die Marktprämie die Differenz aus. Somit wird sichergestellt, dass die Anlagenbetreiber unabhängig von Preisschwankungen einen verlässlichen Gesamterlös erzielen können. Die Berechnung erfolgt jeden Monat und wird vom Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber ausgezahlt.
Vorteile der Marktprämie
Der größte Vorteil der Marktprämie liegt darin, dass Anlagenbetreiber ihren Strom aktiv an der Börse verkaufen können, während sie volle Planungssicherheit behalten. Dadurch fördert die Marktprämie zeitgleich marktwirtschaftliches Verhalten, da die Erlöse in Teilen vom Börsenkurs abhängen, aber bietet auch finanzielle Sicherheit durch ihren Schutzmechanismus. Zuletzt unterstützt die Marktprämie die Integration erneuerbarer Energien in das Stromsystem, da Betreiber motiviert werden, ihre Einspeisung stärker auf den Marktbedarf auszurichten. Finanziert wird die Marktprämie aus dem EEG-Fonds, der durch Mittel aus dem Bundeshaushalt gespeist wird.
Was ist der Mieterstromzuschlag?
Der Mieterstromzuschlag ist eine Förderung für Solarstrom, der nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird, sondern direkt an Mieter:innen im selben Gebäude fließt. Das Ziel ist es, die dezentrale Versorgung durch erneuerbare Energien zu stärken und die Nutzung von Aufdachanlagen in Wohngebäuden attraktiver zu gestalten. Der Zuschlag wird zusätzlich zum Marktpreis gezahlt und zielt darauf ab, die Wirtschaftlichkeit von Miethaus-Projekten zu verbessern. Aktuell sieht der Mieterstromzuschlag so aus:
Aktuelle Fördersätze (1. August 2025 bis 31. Januar 2026):
Die Höhe des Mieterstromzuschlags richtet sich nach der installierten Leistung der Solaranlage:
- Bis 10 kW: 2,56 ct/kWh
- Bis 40 kW: 2,38 ct/kWh
- Bis 1.000 kW: 1,60 ct/kWh
Diese Werte gelten für Anlagen, die in diesem Zeitraum in Betrieb genommen wurden.
Voraussetzungen für den Mieterstromzuschlag nach § 19 EEG
Um als Anlagenbetreiber von dem Mieterstromzuschlag zu profitieren, muss der Strom zum einen aus einer Solaranlage stammen, die sich auf oder an einem Wohngebäude befindet und eine Kapazität von maximal 30 Kilowatt peak erreichen. Der generierte Strom darf nur an Endverbraucher:innen innerhalb des entsprechenden Gebäudes geliefert werden. Eine Einspeisung ins öffentliche Netz ist nicht förderungsfähig. Die Grenze von 30 kWp ist in § 19 Abs. 2 EEG festgelegt und dient dazu, die Förderung auf kleine, dezentrale Anlagen zu konzentrieren, die direkt vor Ort von Mietern genutzt werden.
Zusätzlich sind strikte Vorgaben für die Abrechnung einzuhalten. Da der Anlagenbetreiber nun als Stromlieferant für die Mieter:innen auftritt, muss eine transparente Abrechnung und Messung für den gelieferten Strom sichergestellt sein. Der Mieterstromzuschlag wird pro Kilowattstunde zusätzlich zum vereinbarten Strompreis über den Netzbetreiber ausgezahlt. Voraussetzung für den Zahlungsanspruch ist außerdem die fristgerechte Registrierung der Anlage im Marktstammdatenregister sowie die Mitteilung an den zuständigen Netzbetreiber.
Voraussetzungen und Ausschlüsse

§ 19 EEG schreibt vor, dass Zahlungen nur dann geleistet werden können, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Voraussetzung ist daher, dass der Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt und entweder durch die Direktvermarktung oder als Mieterstrom genutzt wird. Dadurch gelten die Voraussetzungen für die Prämie und den Zuschlag. Darüber hinaus sind die technischen Anforderungen des EEG einzuhalten, wie eine verlässliche Messung und Abrechnung. Zudem gelten bestimmte technische Grenzen: Beispielsweise ist die installierte Leistung der Anlage bei Mieterstrom auf 30 kWp begrenzt, und für die Marktprämie gibt es Anforderungen an die Messeinrichtungen und die Teilnahme an der Direktvermarktung. Werden diese technischen Vorgaben nicht erfüllt, entfällt die Förderung oder kann gekürzt werden.
Gleichzeitig sieht der Paragraf spezifische Ausschlüsse vor, um eine Überforderung zu vermeiden. Zentral ist dabei das Verbot der Doppelförderung. Betreiber dürfen demnach für denselben Strom keine vermiedenen Netzentgelte nach Paragraf 18 der Stromnetzentgeltverordnung in Anspruch nehmen, sobald sie Zahlungen nach § 19 EEG erhalten. Auch entfällt der Anspruch, wenn die Mengen an Strom nicht den Vorgaben des EEG entsprechen oder die dafür notwendigen Meldungen und Nachweise fehlen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Förderung zielgerichtet erfolgt und keine parallelen Subventionen für identische Strommengen gezahlt werden.
Expert:innen Tipps und Zukunftsaussichten für § 19 EEG
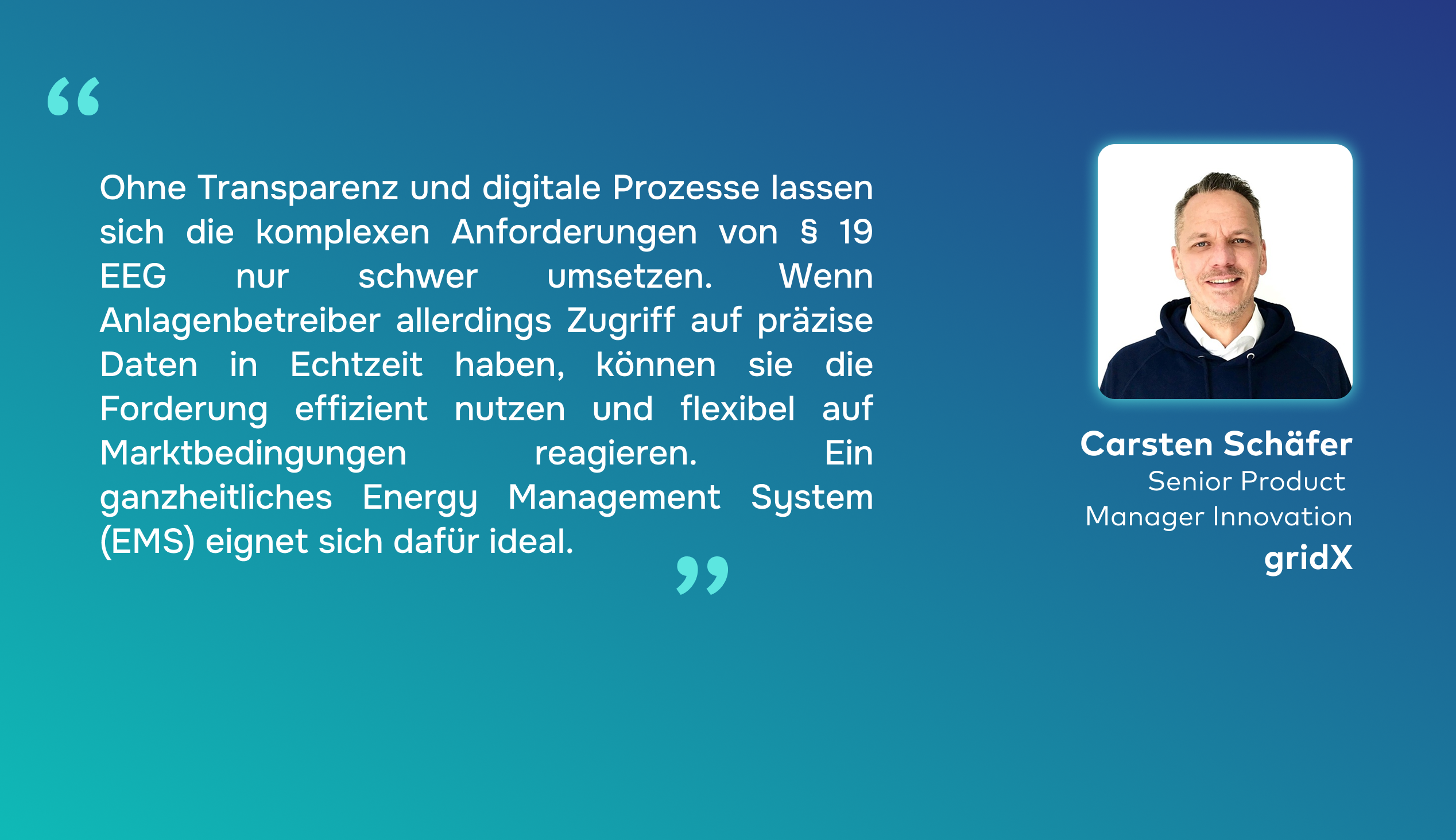
Den Paragrafen 19 EEG in die Praxis umzusetzen, kann für viele Betreiber herausfordernd sein – besonders durch die Kombination von Direktvermarktung, Marktprämie und Mieterstromzuschlag, die eine genaue Messung und Datenbasis erfordern. Daher ist es entscheidend, bereits früh digitale Lösungen zu nutzen, um Messwerte automatisiert zu erfassen, Förderansprüche korrekt geltend zu machen und die Fehlerquote zu verringern.
Mit zunehmender Menge an erneuerbarem Strom werden flexible Vermarktungsstrategien wichtiger, um auf schwankende Börsenpreise reagieren zu können. Gerade hier können digitale Plattformen die Schnittstelle zwischen Anlagenbetreibern, Netzbetreibern und Direktvermarktung sein. Carsten Schäfer, Senior Product Manager Innovation bei gridX sagt dazu: „Ohne Transparenz und digitale Prozesse lassen sich die komplexen Anforderungen von § 19 EEG nur schwer umsetzen. Wenn Anlagenbetreiber allerdings Zugriff auf präzise Daten in Echtzeit haben, können sie die Forderung effizient nutzen und flexibel auf Marktbedingungen reagieren. Ein ganzheitliches Energy Management System (EMS) eignet sich dafür ideal.”
Langfristig wird § 19 EEG immer wichtiger werden, da er als Brücke zwischen staatlicher Förderung und freiem Strommarkt fungiert. Betreiber, die frühzeitig auf digitale Lösungen setzen, sind besser aufgestellt, um von den Ansprüchen zu profitieren und gleichzeitig flexibel auf die regulatorischen Anpassungen zu reagieren.




